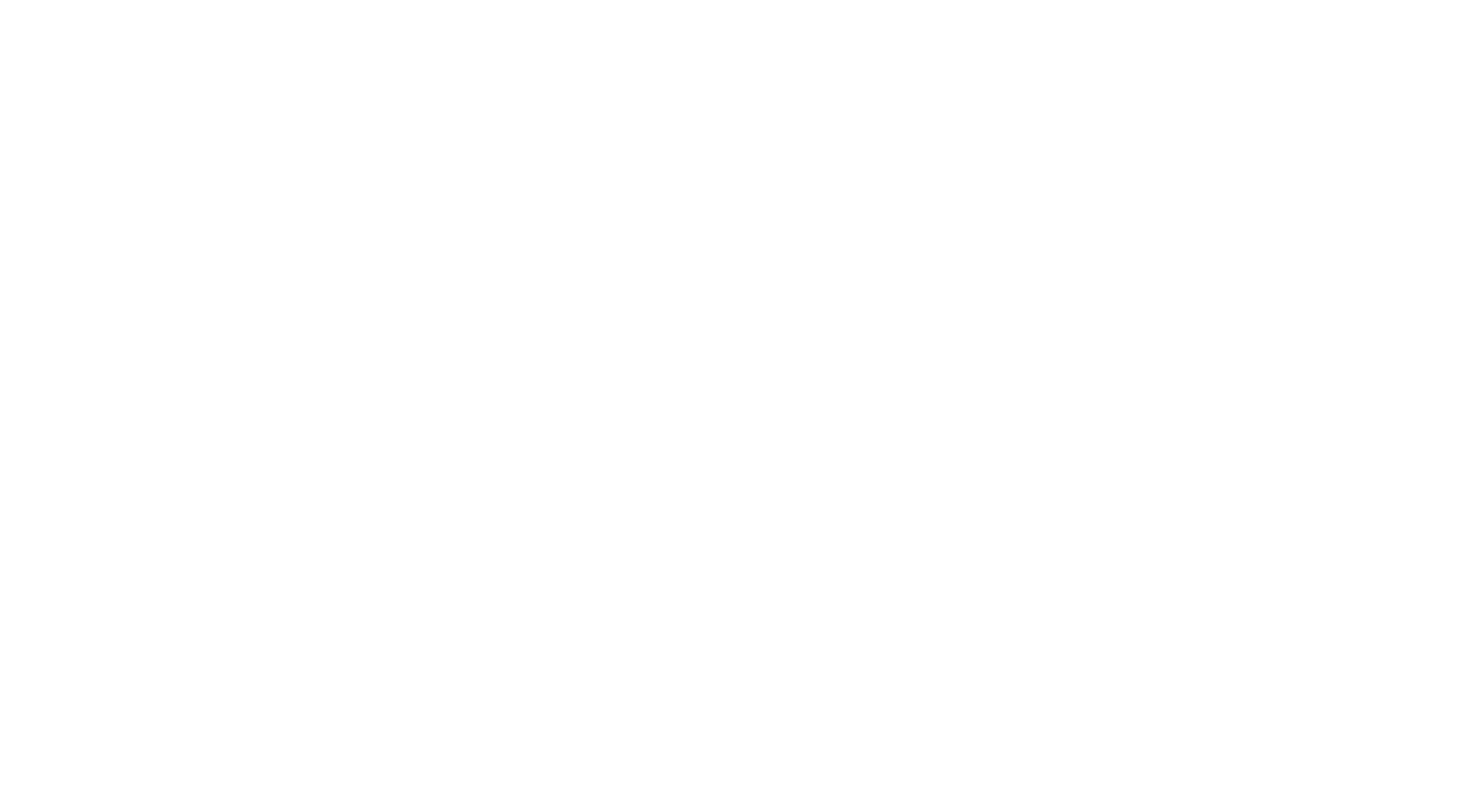Der Leitende Oberarzt der AMEOS Klinik für Innere Medizin in Ueckermünde, Mariusz Pirkos, spricht über das wichtige Thema und gibt hilfreiche Tipps.
Wenn Heilung nicht mehr möglich ist, bleibt noch immer viel zu tun. Palliativmedizin bedeutet nicht das Ende, sondern einen neuen Anfang – einen Anfang für würdevolle Begleitung und Schmerzlinderung. Sie gibt den Betroffenen in ihren letzten Wochen, Monaten oder Jahren einen wertvollen Rahmen, in dem Menschlichkeit und Fürsorge im Mittelpunkt stehen.
„Die Palliativmedizin ist also eine ganzheitliche Betreuung von Patienten mit nichtheilbaren Erkrankungen auf vier Ebenen“, erklärt der Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, Mariusz Pirkos. „Auf der psychologischen, der physiologischen, der sozialen und auch der spirituellen Ebene.“ Dabei wird das gesamte Umfeld der Patientinnen und Patienten in den Blick genommen. „Oftmals ist es so, dass die ganze Familie eines unheilbaren Patienten Unterstützung auf diesem emotional schweren Weg braucht“, weiß der Oberarzt aus Erfahrung.
Das Grundprinzip der Palliativmedizin lautet: „Dem Patienten nicht mehr Zeit, sondern mehr Leben zu geben“, sagt Mariusz Pirkos. Die Experten auf diesem medizinischen Gebiet seien bestrebt, den Betroffenen die letzte Zeit ihres Lebens so angenehm wie möglich zu gestalten, symptomfrei und ohne Schmerzen.
Dabei sei es wichtig, die Patienten so zu behandeln, dass sie weiter am Leben teilnehmen können, sonst verschanzen sie sich möglicherweise in den eigenen vier Wänden und denken an nichts anderes als an die unheilbare Krankheit. Keine schöne Vorstellung, so der Facharzt. Denn letztlich könne so eine Diagnose jeden treffen. Deshalb empfiehlt er gesunden Menschen wie auch unheilbaren Patienten jeden Tag als Geschenk zu sehen. Denn keiner weiß, was morgen ist. „Wir sollten Spaß am Leben haben!“
Damit das möglich ist, versuche man in der Palliativmedizin Symptome, die die Lebensqualität des betroffenen Patienten einschränken, zu beherrschen. „Dazu zählen Luftnot, Schmerzen, Übelkeit, Schwäche, psychische Symptomatiken wie Depressionen oder Angstzustände, Verstopfungen, Durchfall, Juckreiz oder chronische Wunden“, nennt Mariusz Pirkos einige
unangenehme Begleiterscheinungen bei unheilbaren Erkrankungen wie beispielsweise Tumoren.
„Des Weiteren umfasst die Palliativtherapie Hilfe bei allen psychosozialen Problemen“, erläutert der Facharzt. Sie reiche von der Patientenverfügung über die Organisation der Pflege bis hin zur Seelsorge oder einer Psychotherapie. Zudem werde auch die Unterstützung der Angehörigen fest in den Blick genommen und das Umfeld des Patienten betrachtet. Denn manchmal lebe die Familie weit weg. „Aber grundsätzlich gilt: Der Patient ist der Chef! Er sagt, was er möchte.
Unterschiede zwischen kurativer und palliativer Therapie
Während die kurative Therapie das Ziel verfolgt, eine Krankheit zu heilen oder deren Ursachen zu beseitigen, sie kommt beispielsweise bei Infektionen, Tumoren in frühen Stadien oder heilbaren Erkrankungen zum Einsatz, so konzentriert sich die Palliativmedizin darauf, Symptome zu lindern und die Lebensqualität von unheilbar kranken Menschen zu verbessern. Sie wird angewendet, wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist, etwa in fortgeschrittenen Stadien von Krebs oder bei schweren chronischen Erkrankungen, erläutert Oberarzt Mariusz Pirkos. Einfach gesagt: Kurativ will heilen, palliativ will lindern.
„Während in der kurativen Therapie beispielsweise therapiebedingte Nebenwirkungen zugemutet werden, so setzt man in der palliativen Medizin auf schonende Therapieformen, die lediglich das Leiden und die Beschwerden des Patienten lindern. Man versucht, beispielsweise durch leichte Chemotherapien, eine möglichst hohe Funktionsfähigkeit und Lebenszufriedenheit des Patienten zu erhalten“, erklärt der Mediziner.
Aufteilung der Palliativversorgung
Es werde in die ambulante und die stationäre Palliativversorgung unterschieden. Ambulant kämen dafür der Hausarzt, Pflegedienste, Hospizdienste, Palliativstützpunkte oder eine spezialisierte ambulante Palliativersorgung (SAPV) infrage. „Stationär bieten allgemeine Krankenhäuser mit Palliativbeauftragten oder nicht spezialisierten Palliativstationen eine Betreuung nicht heilbarer Patienten an. Ebenso gibt es aber auch spezialisierte Palliativstationen, Hospize oder Palliativdienste, die Patienten stationär aufnehmen“, so Mariusz Pirkos.
Außer Ärzten, Pflegepersonal, Sozialarbeitern, Physio-, Ergo- und Musiktherapeuten, Seelsorgern, Ehrenamtlichen sowie der Alternativmedizin seien auch die Familie, Bekannte und Freunde für die Versorgung des Patienten wichtig. „Die Betroffenen wünschen sich Ruhe und Normalität, sie mögen nicht, wenn sich alles um sie dreht.“ Außerdem sei alles erlaubt, was der Patient mag.

Text: U. Hertzfeldt / Foto: Adobe Stock (1) / AMEOS (1)